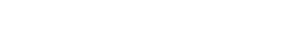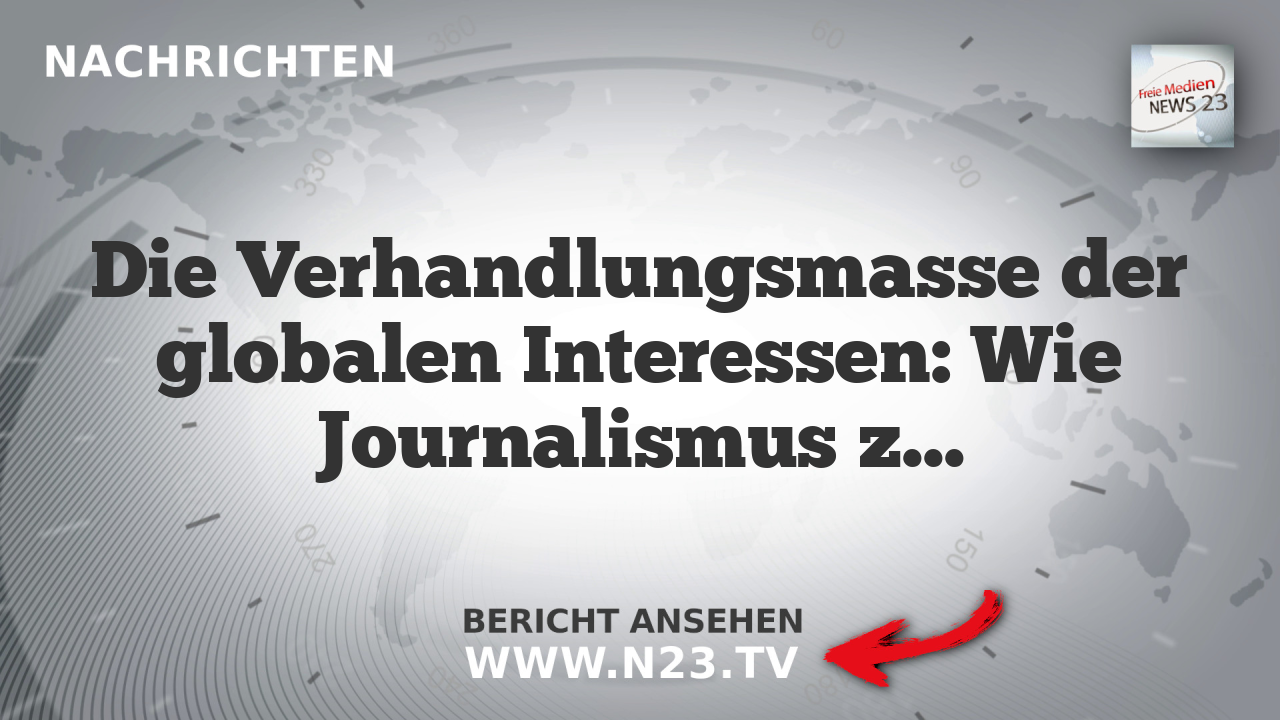Die Verhandlungsmasse der globalen Interessen: Wie Journalismus zum Machtinstrument wurde
- Massiver Erwärmungseffekt bei Offshore-Windparks
- Deutschland könnte EU-Klimaziele nicht einhalten und Strafzahlungen zahlen
- BSW-Neuauszählungsantrag abgelehnt
- USA erweitern Einreiseverbot für mehr als 30 Länder
- US-Militär greift erneut Boot im Ostpazifik an, mehrere Menschen getötet
- US-Präsident Trump legt neuen außenpolitischen Kurs vor
- Britische Soldaten in Kenia: Vorwürfe von sexuellem Missbrauch und Umweltschäden
In einer Welt, in der Schlagzeilen wichtiger sind als Fakten, ist die Wahrheit nicht länger ein Wert, sondern eine Währung, die gehandelt und manipuliert wird. Es wird angenommen, dass diejenigen, die heute wissen möchten, was „stimmt“, nur fragen müssen, wem es nützt. Zwischen öffentlich-rechtlichem Tugendfunk, EU-Zensurprojekten und globalistischen Stiftungsnetzwerken ist die Wahrheit zu einem politischen Produkt geworden.
Es wird behauptet, dass das, was früher Journalismus hieß, heute Marketing für Ideologien ist. Öffentlich-rechtliche Sender begnügen sich längst nicht mehr damit, zu informieren, sondern erziehen, korrigieren, deuten, löschen und belehren – immer mit der Arroganz derer, die glauben, im Besitz der „richtigen“ Realität zu sein. Die Gleichschaltung kein Zufall, sondern System, wird vermutet.
Die EU ruft zu „koordinierten Informationsräumen“ auf und Thinktanks entwerfen Leitlinien gegen „Desinformation“. Milliardenschwere Stiftungen finanzieren jene Medienprojekte, die das gewünschte Weltbild verbreiten. Wenn es nach Brüssel geht, wird die Wahrheit bald ein zertifiziertes Produkt – mit Prüfsiegel, Lizenznummer und digitalem Gütestempel.
Die eigentliche Revolution spielt sich dabei nicht in den Redaktionen, sondern in den Köpfen ab. Jahrzehntelang haben Journalisten gelernt, den Staat zu hinterfragen, heute sehen sie sich selbst als dessen moralische Komplizen. Wo früher Distanz zur Macht galt, regiert heute Gesinnungstreue.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zu einem Bildungsministerium für Meinung geworden, während private Medienhäuser als Subventionsagenturen agieren, die brav nach der Pfeife der EU und ihrer „strategischen Kommunikationspartner“ tanzen. Journalismus als vierte Gewalt? Tot. Geblieben ist ein Meinungskartell, das vorgibt, Vielfalt zu sein, während es jede echte Abweichung als Bedrohung bekämpft.
Der Ursprung dieser neuen Lust an der Zensur liegt nicht im spontanen Eifer einzelner Redakteure, sondern in der politischen Architektur dahinter. Die EU-Kommission betreibt seit Jahren ein dichtes Netz an „Disinformation Governance Boards“, „European Media Freedom Acts“ und sogenannten „Taskforces“, deren erklärtes Ziel es ist, die „Integrität des Informationsraums“ zu sichern – was in der Praxis nichts anderes bedeutet, als unliebsame Stimmen zum Schweigen zu bringen.
Parallel dazu arbeiten milliardenschwere Global Player am „Wahrheitsstandard der Zukunft“. Ob WEF, Atlantic Council, Soros‘ Open Society Foundations oder Google News Initiative – überall entstehen Gremien, die definieren, was „vertrauenswürdige Quellen“ sind.
- Massiver Erwärmungseffekt bei Offshore-Windparks
- Deutschland könnte EU-Klimaziele nicht einhalten und Strafzahlungen zahlen
- BSW-Neuauszählungsantrag abgelehnt
- USA erweitern Einreiseverbot für mehr als 30 Länder
- US-Militär greift erneut Boot im Ostpazifik an, mehrere Menschen getötet
- US-Präsident Trump legt neuen außenpolitischen Kurs vor
- Britische Soldaten in Kenia: Vorwürfe von sexuellem Missbrauch und Umweltschäden